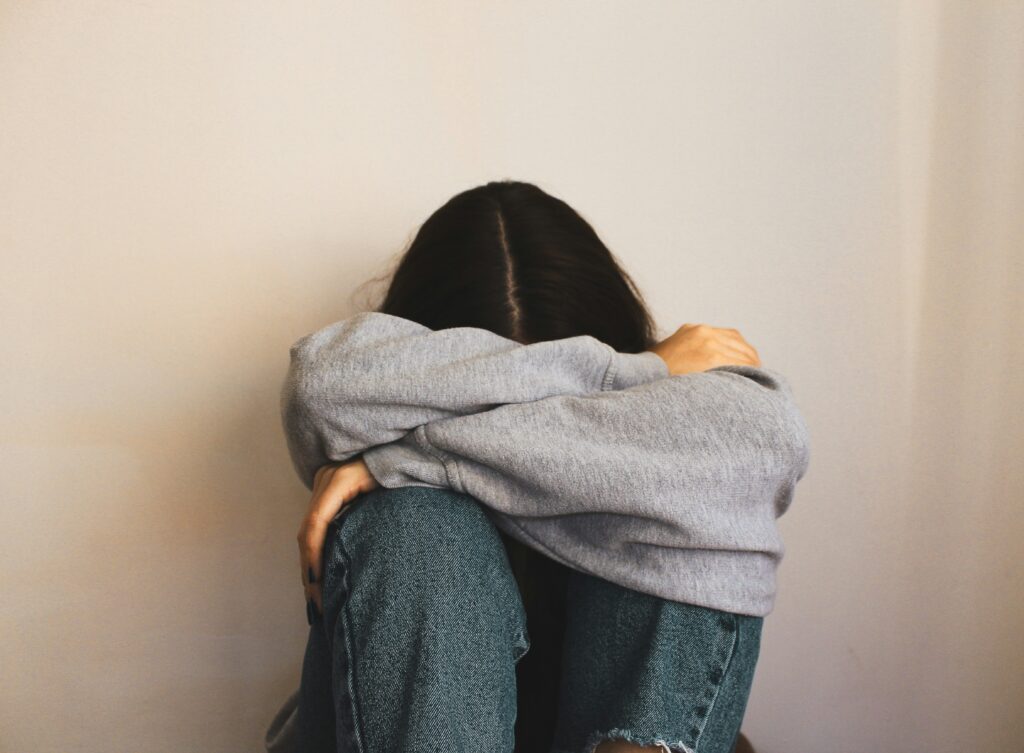
Das Studium ist geprägt von verschiedenen Herausforderungen, Leistungsdruck sowie stetiger Selbstbewertung. Studierende durchlaufen im Studium nicht nur eine fachliche Bildung, sondern auch eine persönliche Weiterentwicklung, die emotionale Belastungen hervorrufen, die sich in Form von Selbstzweifeln im Studium äußern. Gedanken wie „Bin ich gut genug?“, „Andere scheinen alles besser im Griff zu haben“ oder „Was ist, wenn ich die Klausur nicht bestehe?“ sind dabei keine Ausnahme, sondern Teil einer weitverbreiteten Unsicherheit. Diese Zweifel entstehen jedoch nicht zwingend durch tatsächliches Versagen, sondern oft trotz objektiver Erfolge.
Das Imposter-Syndrom: Zwischen Leistung und Selbstzweifeln
Das Impostor-Syndrom, auch bekannt als Hochstapler-Syndrom, beschreibt ein Verhalten, bei dem betroffene Personen davon überzeugt sind, dass sie trotz offensichtlicher Erfolge oder Qualifikationen nicht kompetent oder gut genug sind. Sie denken, dass ihre Leistungen unverdient oder auf einen Zufall zurückzuführen sind. Dieses Gefühl löst den Gedanken aus, ein „Hochstapler“ zu sein und dementsprechend auch die Angst, als solcher identifiziert zu werden, obwohl objektive Nachweise eindeutig das Gegenteil belegen. Dieses Phänomen zeigt sich besonders oft in akademischen und beruflichen Kontexten und kann erheblichen Stress und Selbstzweifel auslösen, die Erfolge blockieren können.
Der innere Dialog und wie dieser unsere Selbstzweifel verstärken kann
Der innere Dialog beschreibt Selbstgespräche, die wir in jeder Situation im Kopf führen. Diese Gedanken können sowohl unterstützend und motivierend, aber auch kritisch und vor allem selbstkritisch sein. Besonders in stressigen oder unsicheren Phasen, wie sie im Studium oft vorkommen, können sich negative Selbstgespräche wie „Ich habe die Klausur nicht bestanden, weil ich nicht gut genug bin und ich werde vermutlich im Laufe des Studiums erfolglos bleiben.“ verstärken und zu einem ständigen Begleiter werden. In diesem Sinne sind innere Dialoge nicht hilfreich, sondern verzerren die Wahrnehmung auf negative Weise. Dies zeigt sich in negativen Gedanken, die das eigene Selbstwertgefühl und die Erwartungen auf Erfolge beeinträchtigen und somit Selbstzweifel im Studium verstärken. Solche Gedanken beeinflussen das Verhalten und die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten.
Handlungsempfehlungen
- Reflektiere regelmäßig deinen inneren Dialog
Durch regelmäßige Selbstreflexion und das bewusste Lenken des inneren Dialogs kannst du Selbstzweifel im Studium hinterfragen und langfristig ein positiveres Bild von dir selbst entwickeln.
- Setze dich regelmäßig hin und reflektiere deinen inneren Dialog. Achte darauf, welche Gedanken du in stressigen oder herausfordernden Momenten hast. Erkenne, wenn Selbstzweifel auftauchen, und versuche, diese mit rationalen und positiven Gedanken zu ersetzen.
- Ersetze negative Selbstgespräche durch positive, stärkende Aussagen. Zum Beispiel statt „Ich werde das nie verstehen“ könntest du sagen „Ich werde immer besser und lerne stetig dazu“.
- Schreibe deine Gedanken auf. Dies hilft, negative Denkmuster zu erkennen und zu verändern.
- Wachstum und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
Das Growth Mindset, das von der Psychologin Carol Dweck entwickelt wurde, basiert auf der Überzeugung, dass unsere Fähigkeiten und Intelligenz durch kontinuierliches Lernen, Anstrengung und Ausdauer entwickelt werden können. Dieses Konzept kann dabei helfen, die Sichtweise zu ändern und somit Selbstzweifel im Studium zu reduzieren.
- Wenn du bei einer Aufgabe nicht vorankommst, versuche den Gedanken „Ich kann das nicht“ abzulegen und dir stattdessen zu sagen „Ich kann das noch nicht“. Diese Formulierung zeigt dir, dass es einen Weg gibt, dich weiterzuentwickeln. Betrachte alle Herausforderungen und Rückschläge als Chance, dich weiterzuentwickeln. Anstatt dich von Misserfolgen entmutigen zu lassen, frage dich, was du aus der Situation lernen kannst. Ein Fehler im Studium ist eine Gelegenheit, das eigene Wissen und die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln.
- Gemeinsam gegen Selbstzweifel im Studium
Bedenke immer, dass du nicht allein mit deinen Selbstzweifeln im Studium bist. Der Austausch mit Kommiliton:innen kann eine wertvolle Unterstützung bieten. Oftmals haben auch andere ähnliche Ängste und Unsicherheiten. Dieser Austausch hilft nicht nur, das Gefühl der Isolation zu überwinden, sondern eröffnet neue Perspektiven und Lösungsansätze. Gespräche mit anderen, die die gleichen Herausforderungen meistern, können dir zeigen, dass Selbstzweifel im Studium eine normale Phase des Studiums sind.
Neben den Kommiliton:innen ist es auch hilfreich, mit Familie oder engen Freunden zu sprechen. Sie bieten nicht nur emotionale Unterstützung, sondern helfen auch dabei, den Blick auf deine Erfolge und Stärken zurückzulenken. Manchmal genügt es, den eigenen Gedanken etwas Raum zu geben und von außen eine andere Perspektive zu erhalten.
Wenn du jedoch merkst, dass die Selbstzweifel im Studium dich stärker belasten oder du das Gefühl hast, dass der akademische Druck überhandnimmt, kann es sehr hilfreich sein, den psychologischen Dienst der Hochschule in Anspruch zu nehmen. Die meisten Hochschulen bieten kostenfreie Beratungsstellen an, die dich dabei unterstützen können, Strategien zum Umgang mit Stress und Ängsten zu entwickeln.
Fußnoten
- Bensberg, G. & Messer, J. (2014). Survivalguide Bachelor. Heidelberg: Springer
- Dweck, C. (2014). The Power of believing that you can improve. Ted Verfügbar unter: https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare (Zugriff am: 10.05.2025)
- Sattler, M. (2024). Weil Erfolg nicht das ist, was du denkst. Die 6 Schlüsselfaktoren für Mut, Mindset und Motivation. Freiburg: Haufe.
Originalbild: Carolina (@a_cat). Verfügbar unter: https://unsplash.com/de/fotos/eine-frau-sitzt-auf-dem-boden-die-arme-um-den-kopf-geschlungen-ghYHNrzS8pk